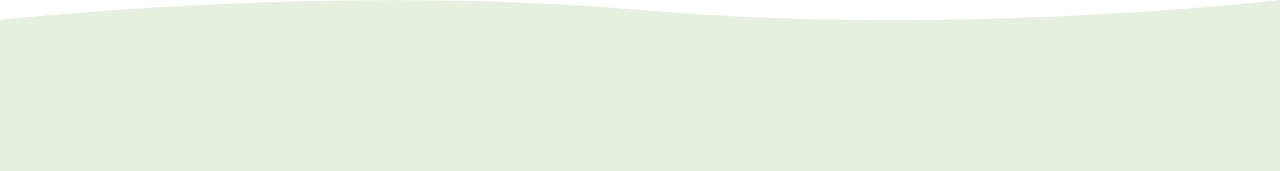
Verdauung anregen mit Molke
Schon von Hippokrates verschrieben, von Alfred Vogel immer wieder empfohlen: Molke, das «Nebenprodukt» der Käserherstellung, fördert die Verdauung und unterstützt unsere Darmflora.
Ist der Darm träge und arbeitet nicht so, wie er sollte, hilft eine Molkenkur. So empfiehlt es unsere Autorin Judith Dominguez, Pflegefachfrau und Biologin. Tatsächlich ist Molke ein sehr altes "Naturheilmittel". Molke wurde eingesetzt, um Krankheiten wie Gicht, Darmbeschwerden oder Hautflechten zu behandeln.
Autorin: Dr. Claudia Rawer, 03.14
Anfang des 19. Jahrhunderts erlebten die Schweiz, Deutschland und Österreich geradezu einen Molkenboom: In berühmten Kurorten wie dem Bergdorf Gais in Appenzell-Ausserrhoden oder in Kreuth bei Tegernsee trafen sich die bürgerliche Gesellschaft und sogar königliche Herrschaften zur Molkenkur.
Deren angebliche Wirkung auf Atemwegs- und Lungenleiden ist inzwischen widerlegt – der Nutzen der Molke für eine gesunde Verdauung jedoch steht ausser Zweifel.
Bei der Molke, die wir heutzutage trinken, handelt es sich nicht mehr um die gleiche, die früher die Bergbauern von der Käserei hinunter ins Tal zu den dort kurenden Herrschaften trugen. Frische Molke ist nur rund zwei Stunden haltbar. Aufgrund dieser schnellen Verderblichkeit findet man im Lebensmittelhandel keine frische Molke mehr, sondern Trockenzubereitungen und Konzentrate. Molke hat heute einen relativ komplizierten Herstellungsprozess hinter sich, bevor sie verkauft werden darf: Pasteurisierung, Entfernung von Milchfett und Milcheiweissen sowie Fermentierung mit Milchsäurebakterien.
Man unterscheidet Süss- und Sauermolke. Die Süssmolke entsteht als Naturprodukt bei der Käseherstellung. Für Sauermolke wird die Süssmolke mit Milchsäurebakterien fermentiert. Dabei entsteht die physiologisch wertvolle L+-Milchsäure.
In den vielen modischen Molkegetränken, die sich mittlerweile in den Regalen der Supermärkte finden, ist meist gesäuerte Süssmolke aus Pulver oder Konzentrat enthalten. Mit der Molke, die schon Alfred Vogel bei Verdauungsstörungen empfahl, haben solche «Drinks» allerdings wenig zu tun: Es handelt sich in aller Regel um ein Gemisch aus Fruchtkonzentrat, Aromen, Farbstoffen und vor allem viel Zucker oder künstlichen Süssstoffen.
Reine Molke bzw. fermentiertes Molkenkonzentrat dagegen enthält wertvolle Mineralstoffe, Spurenelemente und insbesondere die rechtsdrehende Milchsäure L+. Diese wird auch in unserem Stoffwechsel gebildet und hat auf die Verdauung positiven Einfluss, indem sie die Bakterienflora im Darm unterstützt, die Toleranz gegenüber Milchprodukten verbessert und die natürliche Darmbewegung stimuliert.
Das in der Molke enthaltene Kalzium trägt zur normalen Funktion der Verdauungsenzyme bei.
Ein Zusatz von Aronia- und Granatapfelsaft verleiht dem Molkenkonzentrat einen fruchtig-frischen Geschmack und fördert mit den sekundären Pflanzenstoffen den gesundheitlichen Effekt.
Die tiefdunkelblaue Aroniabeere ist ein bemerkenswertes Früchtchen. Im Vergleich zu anderen Beeren besitzt Aronia den höchsten Gehalt an Anthocyanen, nämlich etwa 800 Milligramm auf 100 Gramm Früchte. Zum Vergleich: Die ebenfalls als anthocyanreich geltenden Blaubeeren enthalten in der gleichen Fruchtmenge 160 Milligramm. Auch der Gehalt an antioxidativ wirkenden Tanninen ist in der Aronia weitaus höher als in allen anderen Beeren.
Die Pflanzenfarbstoffe der Gruppe Anthocyane gehören zu den Polyphenolen und haben eine Vielzahl erstaunlicher Eigenschaften: Sie wirken stark antioxidativ und antientzündlich; sie senken Blutdruck, Cholesterin und Lipidwert und verkleinern so das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Sie verbessern den Blutfluss und beugen Thrombose vor. Selbst das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen wie Brust- oder Dickdarmkrebs können sie verringern.
Aronia enthält von Natur aus wenig Fruchtzucker, statt dessen aber viel Sorbit. Das ist ein Zuckeraustauschstoff, der unabhängig von Insulin verstoffwechselt wird. Möglicherweise daher hat die Aronia sich auch schon in der Diabetes-Therapie bewährt.
Die aus Nordamerika stammende Aroniabeere kam bereits um 1900 nach Russland und wurde in den 1940ern als Heilpflanze kultiviert.
Aus der ehemaligen Sowjetunion gelangte sie nach Sachsen und wurde Anfang der 1970er-Jahre erstmalig in der Oberlausitz angebaut. In Westdeutschland jedoch kannte man sie kaum.
Es dauerte bis ins jetzige Jahrtausend, bis Plantagen auch in Nordhessen, Bayern und Niedersachsen entstanden. In der Schweiz wird die herbe Beere erst seit einigen Jahren angepflanzt.
Hauptanbaugebiet ist immer noch Polen mit fast 14 000 Hektar.
Der Granatapfel hiess schon in der griechischen Mythologie «Frucht des Lebens». Tatsächlich hat der Apfel, der keiner ist, medizinisch einiges zu bieten. Granatapfelsaft reduziert das LDL-Cholesterin, senkt den Blutdruck und verbessert die Durchblutung des Herzmuskels, wodurch Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorgebeugt wird. In einer israelischen Studie reduzierten sich bei täglicher Einnahme (ein Jahr lang) von nur 10 Millilitern konzentriertem Granatapfelsaft sogar arteriosklerotische Ablagerungen in der Halsschlagader.
Die Frucht enthält zudem schwache pflanzliche Östrogene, denen eine Wirkung bei Beschwerden in der Menopause und sogar bei der Verhinderung von Brustkrebs zugeschrieben wird.
Bei Prostatakrebs zeigten zwei klinische Studien sehr positive Ergebnisse: Die Granatapfel-Polyphenole senkten bei Männern, die bereits an einem Karzinom litten, deutlich den sogenannten PSA-Wert (Prostata-spezifisches Antigen). Ein Anstieg des PSA-Wertes bedeutet ein Fortschreiten des Krebses. Je langsamer der PSA-Wert steigt, desto besser die Prognose und die Lebenserwartung.
Granatapfelsaft (ein Glas am Tag therapiebegleitend, ein halbes Glas zur Vorbeugung) wird inzwischen auch von Schulmedizinern zur Behandlung und Prävention von Prostatakrebs empfohlen.
Ausserdem ist der Granatapfel reich an Kalium, Vitamin C, Kalzium und Eisen. Ein besonders interessanter Inhaltsstoff ist die Ellagsäure, die zu den antioxidativ, antiviral, antimikrobiell und antikarzinogen wirkenden Polyphenolen gehört und eine besonders hohe Schutzwirkung hat.
Sie findet sich nur in wenigen Obstarten wie Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und Trauben sowie in Walnüssen, und gar nicht in Gemüse. Im Granatapfel ist die Ellagsäure-Konzentration besonders hoch.
Ursprünglich heimisch im Nahen und Fernen Osten werden Granatäpfel nun im ganzen Mittelmeer-Raum angebaut. Von dort findet er vor allem im Herbst und Winter den Weg zu uns.